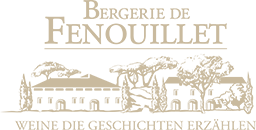Als Cuvee bezeichnen wir die Zusammenstellung von Weinen verschiedener Traubensorten. Wir befinden uns im Januar 1999. Die notarielle Verurkundung von Fenouillet liegt zwei Monate zurück. Wir haben den Besitz angetreten. Bis anhin war ich als Aussenstehender und Betrachter vor Ort. Jetzt spüre ich die Verpflichtung und Verantwortung.
Das Weingut kommt mir vor wie ein verwinkeltes, auf einem Felsvorsprung errichtetes Dorf in Ligurien. Da herrscht Absturzgefahr. Das Gewirr von Wegen und Sackgassen lassen einem orientierungsios werden. Und die Parzellen mit ihren, auf urwüchsigem Untergrund gepflanzten Reben? Sie gleichen den verwunschenen Burgen englischer Grafschaften mit ihren unzähligen geheimnisvollen Kammern und Räumen. Allesamt mit bemerkenswerten Schlössern versehen und zugeschlossen. Das macht sie interessant. Sie wecken meine Neugierde. Doch wo sind die Schlüssel?
Sie fehlen. Sie sind verloren gegangen. Das Bewirtschaftungskonzept unserer Vorgänger war ein Passepartout. Vereinheitlichen und vereinfachen waren Bedingung. Schematische Gleichförmigkeit und Übernutzung sind das Resultat. Die ursprüngliche Schönheit und der Schatz von Fenouillet haben sich zurückgezogen. Ich erahne die bevorstehende Arbeit, ich benötige Zelt, viel Zeit. Wird sie mir vergönnt sein? Der Faktor Zeit wird zu meiner grössten Herausforderung. Da bin ich mir nun ganz sicher.
Die fehlenden Schlüssel. Da stehen Traubensorten, die ich noch nie gekeltert habe. Die Parzellen befinden sich in Lagen, deren Mikroklima ich nicht kenne. Das mediterrane, willkürliche Wetter habe ich bis anhin weder gelebt noch erlebt. Kurz, es fehlt die ganze Fenouillet spezifische Erfahrung. Behutsam gehen wir ans Werk.
Übernutzte, ermüdete Parzellen roden wir. Das Schnitt- und Erziehungssystem unserer Reben stellen wir um. Vernünftige Erträge und physiologisches Gleichgewicht sind das Ziel. Doch unsere Reben, an Hochgeschwindigkeit und Maximalertrag gewohnt, lassen das nicht zu. Sie schlagen zurück. Unausgewogene Reife, beinahe unberechenbare Erträge und erhöhter Krankheitsbefall sind die Folgen. Von den ersten vier Ernten verkaufe ich ungefähr 60% als Trauben. Ihre Qualität ist minderwertig. Sie zu keltern bedeutet Enttäuschung und Demotivation. Die qualitativ einwandfreien Partien keltere ich parzellenweise und jede Sorte separat, ich lasse sie gewähren. Ich will dem Lagen- und Sortencharakter auf die Spur kommen.
Es entstehen ganz unterschiedliche Weintypen. Sie sind geprägt vom Sortencharakter, der Lage, den Böden und dem mürrischen Klima. Sie haben Ecken und Kanten, Dellen und gar Löcher. Sie sind teilweise holprig und unausgewogen. Nur die Zusammenstellung verschiedener Weine erlaubt es, die gewünschte Harmonie und Ausgewogenheit zu finden. DIE CUVEE WIRD DAMIT ZUR PFLICHT. Die ersten Jahre sind deshalb ausschliesslich Cuvee-Jahre. Erst mit der fünften Ernte keltere ich einen Monocepage.
Monocepage oder Cuvee? Gut oder Mittelmass? Oh nein, diese Feststellung greift viel zu kurz. Die Schlüssel zu dieser Frage sind anderswo versteckt. Doch das ist wiederum eine ganz andere Geschichte. Es bleibt spannend. Verweilen Sie weiterhin mit uns. Ich freue mich von ihnen zu hören.
Monocepage:
Wein, der zu 100% der gleichen Traubensorte entstammt.